Für keine Phase in der deutschen Geschichte wurden Frauen nachträglich mehr bewundert als für die Nachkriegszeit. Bis heute hält sich hartnäckig die Legende der Trümmerfrauen. Wie die Frauen selbst aber die damalige Zeit erlebten, ist kaum bekannt. Welche Hoffnungen hegten sie? Wie erfuhren sie die belastenden Lebensumstände? Und was dachten sie, als die neu empfundene Freiheit bald wieder den alten Machtverhältnissen weichen musste?
Miriam Gebhardt beschreibt das Lebensgefühl deutscher Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg eindringlich, persönlich und mit viel Empathie. Dazu hat sie in bis dahin unerreichter Dichte Selbstzeugnisse von Frauen ausgewertet und stellt konsequent deren Erleben in den Fokus. Sie zeigt, warum sich die meisten Frauen nicht aus alten Rollenmustern befreien konnten, wie es einigen gelang, neue Wege einzuschlagen – und wie diese Erfahrungen unser Leben bis heute prägen.
Ein beeindruckendes Werk, das nicht nur die Vergangenheit beleuchtet, sondern auch wichtige aktuelle Fragen aufwirft.
Quelle: Herder-Verlag
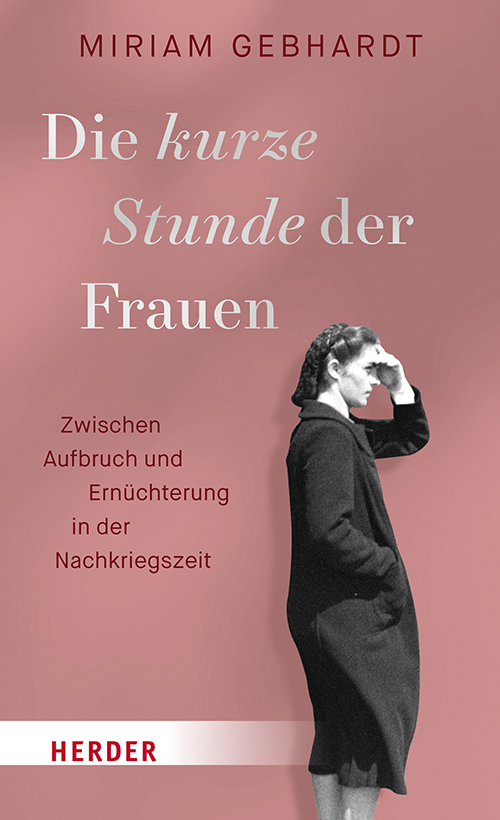
Vielen Dank an den Herder-Verlag für dieses Rezensionsexemplar!
Mein Opa war derjenige, der bei mir in meiner Jugend das Interesse an historischen (Sach-)Büchern weckte, wobei sein Fokus auf dem Zweiten Weltkrieg lag. Und in der unmittelbaren Nachkriegszeit kommt man natürlich nicht umhin, von den Trümmerfrauen zu hören. Allerdings hatte ich mich davon abgesehen bisher kaum mit der Stellung und dem Selbstbild von Frauen in der Zeit unmittelbar nach Kriegsende beschäftigt. Als ich dann den Klappentext zu diesem Buch gelesen habe, war ich sehr gespannt, was ich aus Die kurze Stunde der Frauen wohl lernen würde. Und das ist einiges!
Die große Frage, die dieses Buch zu beantworten sucht, habe wohl nicht nur ich mir schon gestellt: wie kann es sein, dass Frauen dafür gerühmt wurden, zum Ende des Kriegs und in der Zeit danach „den Laden zusammengehalten“ zu haben, zahlreiche Aufgaben übernommen haben, die vermeintlich Männer-Sache waren, und die Gleichstellung von Mann und Frau dennoch Jahrzehnte später ein gesellschaftliches Problem ist?
Dieser Frage geht Miriam Gebhardt unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte nach. Sie blickt darauf, inwiefern Frauen besonders geeignet waren, nach dem Krieg das Symbol für den Wiederaufbau Deutschlands zu werden und das, obwohl sie in der Nazi-Zeit ebenfalls Täterinnen waren. Auch die verschiedenen Rollen als Ehefrau, Mutter und Berufstätige und die jeweiligen Erwartungen kommen zur Sprache. Sehr interessant war in meinen Augen die Beschreibung dessen, wie sich der Blick auf die „richtige“ Kindererziehung entwickelte. Gebhardt geht beispielsweise auch darauf ein, wie Frauen politisch tätig waren und wie relevant sie für die Familien bei der Sicherung des Überlebens nach dem Krieg waren.
Auch die unterschiedliche Entwicklung in der DDR und BRD spielt eine Rolle. Sie zeigt, dass die beiden Staaten ideologisch sehr verschieden gewesen sein mögen, sich in ihrem Blick auf die Kernfamilie und das Ideal der Mütterlichkeit aber sehr ähnlich waren. Das ist in meinen Augen so spannend, weil ich (sozialisiert im ehemaligen Westdeutschland) in der Schule und zuhause kaum etwas über die DDR gelernt habe und sich die Erzählungen der deutsch-deutschen Trennung stark auf die Unterschiede konzentrieren. Die kurze Stunde der Frauen zeigt, dass das nicht unbedingt der Fall ist.
Miriam Gebhardt zeichnet in diesem Buch die Entwicklung gesellschaftlicher Ansichten und Normen in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nach und wie diese bis heute nachwirkt. Sie zeigt, dass die Entwicklung zur Hausfrauenehe in Westdeutschland etwas war, dass nicht ausschließlich von den Männern gewollt war. Es wird deutlich, wie ähnlich sich BRD und DDR in vielerlei Hinsicht waren und auch, dass die Verklärung der Trümmerfrauen ein Mythos ist, Frauen in der (Nach-)Kriegszeit aber eine entscheidende Rolle spielten – wie vorher schon und seitdem auch.
Wahrscheinlich gab es keine Zeit vorher oder nachher, in der es so kompliziert war, das alte Dilemma der bürgerlichen Geschlechterordnung auszuhalten.
S. 255

Über Miriam Gebhardt:
Gebhardt wurde 1962 geboren. Die Historikerin promovierte an der Uni Münster und habilitierte sich in Konstanz, wo sie heute als Professorin tätig ist. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht und ist journalistisch u.a. für die ZEIT tätig.
Gebhardt lebt bei München.
Quelle: Website der Autorin
WERBUNG
Hardcover: ISBN 978-3-451-39938-1 | 24 €
eBook: ISBN 978-3-451-83182-9 | 18,99 €
272 Seiten | erschienen 2024
Verlagswebseite zum Buch
Bildquellen
Cover: Herder-Verlag
Autorin: Website von Miriam Gebhardt
